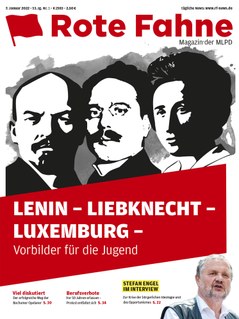Rote Fahne 01/2022
50 Jahre Berufsverbote – Gib Antikommunismus keine Chance!
Am 28. Januar 1972 beschlossen die Ministerpräsidenten der Bundesländer auf Vorschlag von Bundeskanzler Willy Brandt (SPD) den sogenannten Radikalenerlass

„Nach 3,5 Millionen Überprüfungen wurden 11 000 Verfahren eröffnet und 1500 Berufsverbote erteilt. Marxisten-Leninisten wurden als Linksextremisten diffamiert und vom Verfassungschutz beobachtet,“ schreibt dazu Stefan Engel in seinem Buch „Die Krise der bürgerlichen Ideologie und des Antikommunismus“.1
Er legt auch dar, dass diese besondere Form der staatlichen Unterdrückung letztlich aus der Defensive des Antikommunismus heraus geschah. Denn beflügelt durch Befreiungskämpfe in vielen Ländern der Welt und die Große Proletarische Kulturrevolution in China hatte der Sozialismus in den 1960er-Jahren neues Ansehen vor allem unter der Jugend gewonnen.
Nach der abgeebbten antiautoritären Studentenbewegung entstand eine noch stark kleinbürgerlich geprägte „marxistisch-leninistische Bewegung“ („ML-Bewegung“). In der ersten Hälfte der 1970-Jahre umfasste sie vor allem Tausende Studenten, Hunderte Lehrlinge und wenige revolutionäre Arbeiter wie Willi Dickhut – später Mitbegründer der MLPD.
Breiter Widerstand gegen Berufsverbote
Die Berufsverbote zerstörten die Lebensperspektive Tausender. Damit riefen sie aber auch einen breiten Widerstand hervor und setzten den Antikommunismus weiter unter Druck. Überall entwickelten sich Demonstrationen, Schülerboykotts, Unterschriftensammlungen. Zeitweise gab es auch im Ausland Hunderte Aktionskomitees gegen die Berufsverbote. Das Wort „Berufsverbot“ wurde in andere Sprachen als besondere Form staatlicher Unterdrückung übernommen.
Die „ILO“ (International Labour Organisation“) eine Unterorganisation der UN verurteilte sie, später auch der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte. Unter dem Druck des Widerstands mussten Gerichte erteilte Berufsverbote teilweise wieder zurücknehmen, Betroffene wieder einstellen. Wie zum Beispiel den Lehrer Klaus Lipps in Baden-Württemberg und andere. Die Regelanfragen beim „Verfassungsschutz“ wurden teilweise ausgesetzt.
Wer waren die Opfer?
Opfer der Berufsverbote waren – neben Lokführern und Postbeamten bis zu Hochschullehrern – viele Lehrer. Ein großer Teil waren Mitglieder der revisionistischen DKP. Obwohl sie bei ihrer Gründung 1968 marxistisch-leninistische Grundpositionen aufgegeben hatte, waren dem bürgerlichen Staat auch vermeintliche DKP-Mitglieder wegen ihres oft revolutionären Anspruchs suspekt.
Nach der Gründung der MLPD 1982 kandidierten auch ihr zugerechnete Lehrer – Inge Dressler und Wolfgang Serway – bei Kommunalwahlen in Stuttgart. Sie beschränkten sich nicht auf das Recht der Kandidatur für eine zugelassene Partei. Vielmehr verteidigten und propagierten sie auch deren revolutionäres Programm. Die Verteidigung aller demokratischen Grundrechte verbanden sie mit prinzipieller Ablehnung des umweltzerstörenden Rechts auf Privateigentum an Produktionsmitteln und der herrschenden Diktatur der Monopole.
Die Quittung: Beide wurden mit Berufsverbot belegt. Solidarität mit den Mitgliedern der DKP war und ist für sie und die MLPD selbstverständlich. Dagegen verweigerte die DKP weitgehend die Solidarität gegenüber Genossinnen und Genossen der MLPD, weil diese den sowjetischen Sozialimperialismus kritisierte.
Solidarität mit Inge Dressler und Wolfgang Serway
In der Öffentlichkeit entwickelte sich ein breites Aufbegehren und Solidarität mit den marxistisch-leninistischen Lehrern unter Schülern, Eltern, in der Gewerkschaft. Mehr als 5000 Unterschriften wurden gesammelt, in zahlreichen Leserbriefen wurde protestiert und die Auseinandersetzung wurde in die Betriebe getragen. Die noch sehr junge MLPD wurde breiter bekannt. Die kleinbürgerliche „ML-Bewegung“ zersetzte sich hingegen zunehmend.
Unfähig, marxistisch-leninistische Grundsätze schöpferisch anzuwenden, machten ihre Führer diese dafür verantwortlich. Als Kronzeugen des Antikommunismus wurden sie dafür mit hochdotierten Stellen an Hochschulen, in staatlichen Einrichtungen, Politik und Massenmedien belohnt.
Mit Winfried Kretschmann wurde 2011 ein zeitweiliges Berufsverbotsopfer erster grüner Ministerpräsident. Schnöde erklärte er auf Anfrage der Initiative gegen Berufsverbote, dass nötige Einzelfallprüfungen wegen Aktenvernichtung nicht mehr möglich seien. Und schließlich habe es auch Betroffene gegeben, „deren Entlassung richtig war“.
Kein Ausrutscher, sondern antikommunistische Ausrichtung der zur Regierungspartei gemauserten ehemaligen kleinbürgerlichen Protestpartei.
Und was macht die neue Regierung?
Die neue Ampelkoalition will sogar mithilfe des „Verfassungsschutzes“ eine Wiederbelebung der Berufsverbotspraxis. Ausdrücklich formuliert sie im Koalitionsvertrag (S. 9) „dass Verfassungsfeinde schneller als bisher“ aus dem öffentlichen Dienst „entfernt werden“ sollen.
Zugleich gerät die Berufsverbotspraxis 50 Jahre nach ihrer Einführung immer mehr in die Kritik. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) fordert die Rehabilitierung und Entschädigung der Opfer. Es gibt einen breit unterstützten Aufruf „50 Jahre Berufsverbote – Demokratische Grundrechte verteidigen!“ und die wachsende Bewegung „Gib Antikommunismus keine Chance!“. Deren Unterzeichnung sind ein wichtiger Schritt zum Kampf gegen diese Pläne.