Artikelserie "Künstliche Intelligenz" - Zweiter Teil
Wie beurteilen wir die Entwicklung der „Künstlichen Intelligenz“?
Im ersten Teil der Reihe haben wir uns mit der Geschichte der „Künstlichen Intelligenz“ beschäftigt und auch schon eine erste Einschätzung vorgenommen. Das wollen wir hier vertiefen.
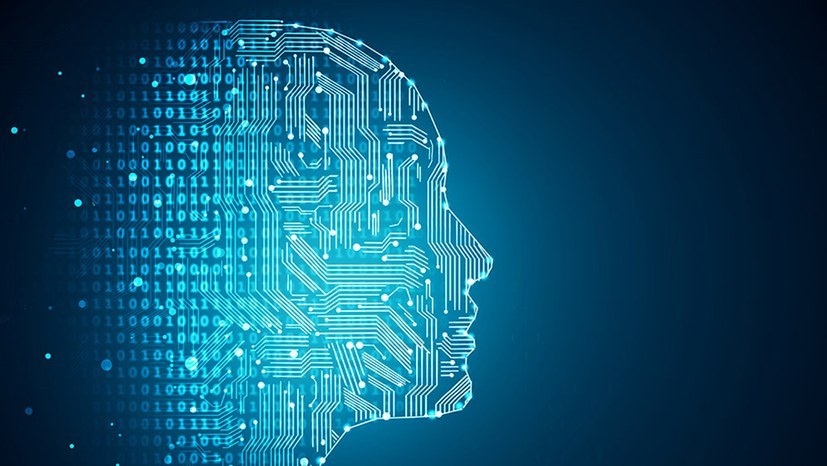
Zunächst noch vielen Dank für die Zuschriften zum ersten Teil, die durchweg hilfreich waren. Ein Leser wies berechtigt darauf hin, dass d.er erste Teil an einer Stelle unkritisch den Begriff des "Lernens" der Sprachmodelle übernahm. Richtig ist hier, vom "Training" zu sprechen; menschliches Lernen ist ein anderer Prozess, der eine Veränderung des Denkens, Fühlens und Handelns beinhaltet.
In der Beurteilung der KI gibt es kleinbürgerliche Einflüsse
In der Beurteilung der „Künstlichen Intelligenz“ gibt es verschiedene kleinbürgerliche Einflüsse. Der erste ist der grenzenlose Technikoptimismus. Er erklärt KI zum Allheilmittel, mit dem die Probleme des Kapitalismus überwunden und ein Paradies für alle geschaffen werden könne. Ein Paradebeispiel lieferte der amerikanische Investor Marc Andreessen: „Eine Welt, in der die Löhne der Menschen durch KI – logischerweise, notwendigerweise – drastisch sinken, ist eine Welt, in der das Produktivitätswachstum explodiert und die Preise für Waren und Dienstleistungen auf nahezu Null sinken. Ein Füllhorn für den Verbraucher. Alles, was man braucht und will, für ein paar Cent.“
Der zweite ist eine defätistische Weltuntergangsstimmung, nach der durch „Künstliche Intelligenz“ die Arbeiter überflüssig werden und vollständig durch Maschinen ersetzt würden. Das ist aber unmöglich und verkennt, dass jede noch so gute und komplexe Maschine auch entwickelt, produziert, gewartet, gesteuert, überwacht, geprüft oder repariert werden muss. Eine Maschine alleine erschafft keinen Mehrwert, nur der Arbeiter, der mit ihr arbeitet. Schon Karl Marx erkannte, „daß der Mehrwert nicht aus den Arbeitskräften entspringt, welche der Kapitalist durch die Maschine ersetzt hat, sondern umgekehrt aus den Arbeitskräften, welche er an ihr beschäftigt (Karl Marx, »Das Kapital. Erster Band«, Marx/Engels, Werke, Bd. 23, S. 429).
Folgen der KI-Entwicklung nicht losgelöst von der kapitalistischen Gesellschaftsordnung untersuchen
Auch die Folgen der Entwicklung der „Künstlichen Intelligenz“ kann man nicht losgelöst von der kapitalistischen Gesellschaftsordnung untersuchen. Künstliche Intelligenz begegnet uns im Alltag am häufigsten in der Form von Chat- und Sprachrobotern statt echten Menschen bei immer mehr Unternehmen oder auch einer Flut von generierten und nichtssagenden Nachrichten, Webseiten und Social Media Beiträgen usw. Nicht zuletzt sind tausende Arbeitsplätze in Gefahr, weil die Aufgaben der Betroffenen durch KI abgelöst werden sollen. So entwickelte das DFKI (Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz) einen Ernteroboter, der in der Lage ist, auch empfindliche Früchte wie Erdbeeren zu ernten, ohne sie zu zerdrücken. Damit sollen tausende Erntehelfer überflüssig gemacht werden.
In vielen Firmen ist die Nutzung von KI mittlerweile verpflichtend. Dabei geht die Arbeit mit KI selten wirklich so schnell, wie es behauptet wird. Zu oft noch macht die „Künstliche Intelligenz“ hanebüchene Fehler (dazu mehr im nächsten Teil). Aber weil im Kapitalismus nur der kurzfristige Maximalprofit zählt, wird das trotzdem erwartet und die Leute werden unter Druck gesetzt. Das regt die Betroffenen mit Recht auf, und nicht wenige haben mittlerweile die Nase voll vom KI-Hype.
Militärische Nutzung
Weniger beachtet, aber genauso wichtig ist die militärische Nutzung der Technik. Sie ist eine Haupttriebkraft bei ihrer Entwicklung. Die bekannteste Form ist die Software „Gotham“ der US-Firma Palantir. Sie nutzt die Technik der „Künstlichen Intelligenz“, um Daten aus Dutzenden verschiedener Datenbanken zusammenzuführen, auszuwerten und Ziele zu identifizieren. Der frühere CIA- und NSA-Chef Michael Hayden räumt freimütig ein, dass Palantir dazu entwickelt und genutzt wird, um Menschen zu töten (1). Die Übergänge von der „zivilen“ zur militärischen Nutzung sind bei Palantir fließend. Das hindert die Bundesregierung nicht daran, den Einsatz dieser Software zur „Kriminalitätsbekämpfung“ zu planen; mehrere Bundesländer (NRW, Hessen und Bayern) tun es bereits. Auch die israelische Armee nutzte „Künstliche Intelligenz“ in Form des Systems „Gospel“ bei ihrem Völkermord in Gaza.
Potenzial der Technik für den Aufbau des Sozialismus
Es wäre trotzdem falsch, die Technik der „Künstlichen Intelligenz“ einseitig abzulehnen. Wir müssen eine differenziert Beurteilung vom marxistisch-leninistischen Klassenstandpunkt vornehmen. Die beschriebenen negativen Auswirkungen sind das eine. Das Potenzial der Technik für den Aufbau des Sozialismus ist das andere. Nochmal aus dem „Revolutionären Weg 37“: „Die moderne Technik erweitert die Fähigkeiten der Arbeiterklasse, ersetzt sie aber nicht. Moderne Arbeiter können aus dem unmittelbaren Produktionsprozess heraustreten und zu Dirigenten der internationalen Produktion werden. So wird die materielle Vorbereitung des Sozialismus vervollkommnet. (Revolutionärer Weg 37/2022 „Die Krise der bürgerlichen Ideologie und des Opportunismus“, S. 85)
Der Einsatz der Technik, um wiederkehrende Aufgaben zu vereinfachen und zu automatisieren, erlaubt den Arbeitern mehr Zeit für ideologisch-politische Betätigung und den Aufbau der sozialistischen Gesellschaft zu verwenden. Bezogen auf den erwähnten Ernteroboter wird das praktisch deutlich - es ist ja nicht per se schlecht, Menschen von dieser anstrengenden und zeitraubenden Tätigkeit zu entlasten. Unter den Bedingungen des Kapitalismus wird daraus eine akute Gefahr für die Arbeitsplätze. Die Lösung ist nicht die Abschaffung der KI, sondern die Abschaffung des Kapitalismus. Unter sozialistischen Bedingungen würde man a) Ressourcen bündeln und jedes Teil nur einmal bauen statt fünf oder mehr Konkurrenzprodukte, b) die notwendige Energie über regenerative Energien bereit stellen und c) mehr Konzentration auf Effizienz und maßgeschneiderte Lösungen legen statt mit immer höheren Investitionen möglichst alles in kürzester Zeit erreichen zu wollen.
Im kapitalistischen Staat gibt es keine "Macht zu verteilen"
Die Technik ist nicht die Lösung aller Probleme. Der eingangs beschriebene „Technikoptimismus“ hat weitreichende Auswirkungen auch in einem überwiegend kleinbürgerlich geprägten Teil der Bewegung gegen staatliche Überwachung, Vorratsdatenspeicherung etc. Demnach ist die technische Entwicklung der Schlüssel zur Überwindung der Klassengegensätze im Kapitalismus und zur „Weiterentwicklung der Demokratie“: „Es ist in der heutigen Zeit ein Leichtes, große Mengen an Informationen zu durchsuchen und jedem zugänglich zu machen. Das alles ermöglicht ganz neue und vorher undenkbare Lösungsansätze für die Verteilung von Macht im Staate“ (Grundsatzprogramm der Piratenpartei) (2). Im kapitalistischen Staat gibt es allerdings keine Macht zu verteilen. Diese liegt in den Händen der Monopole und wird von diesen auch nicht geteilt. Der kapitalistische Staat ist das Instrument zur Aufrechterhaltung dieser Macht und kann nicht einfach „transformiert“ oder „weiterentwickelt“ werden. Entscheidend ist die Überwindung der kapitalistischen Machtverhältnisse und der Aufbau eines neuen, sozialistischen Staates, bei dem diese Techniken durchaus hilfreich sein können.
Auch heute schon können wir diese Technik sinnvoll nutzen, um unsere politische Arbeit zu effektivieren. Darum geht es im nächsten Teil dieser Reihe. Auch ihre Geringschätzung ist keinesfalls richtig.




